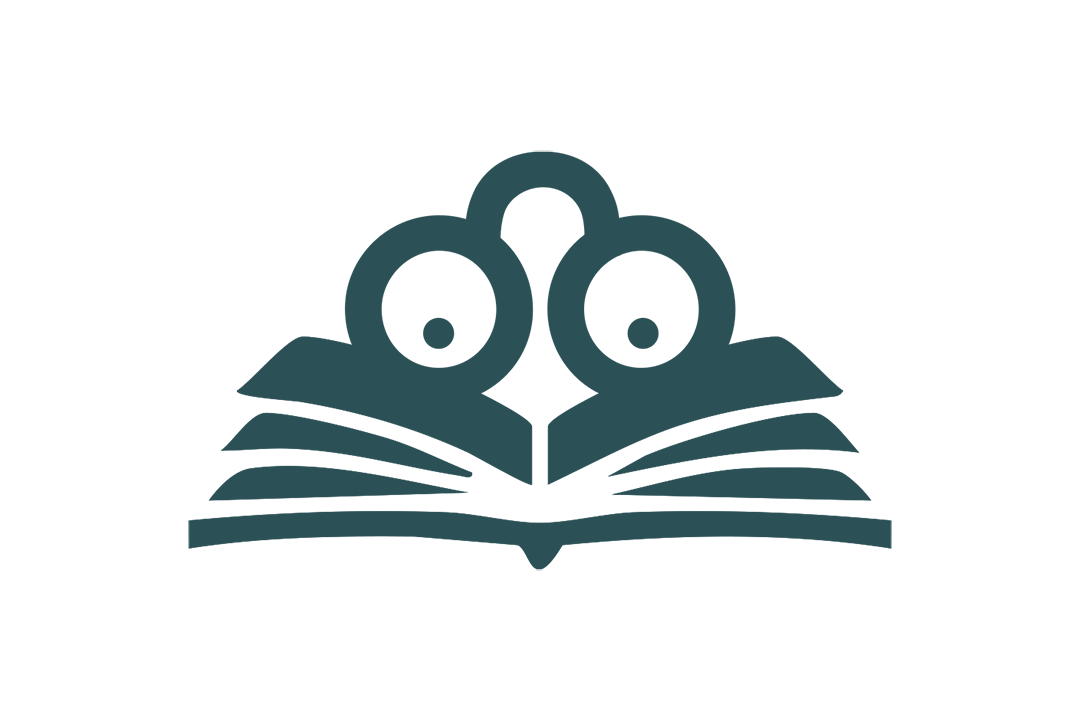Die 15 Top Bücher für Yoganerds 🤓
Was du lesen solltest, wenn du ein echter Yoganerd werden willst.
Wer tiefer in die Geschichte des Yogas und seine Traditionen einsteigen möchte, der sollte in den folgenden 15 Büchern schmökern. Auch wenn ich versucht habe, deutsche Publikationen zu berücksichtigen, sind die meisten auf Englisch, denn deutsche sind rar. Diese Liste ist nicht die letzte Wahrheit – es gibt einige weitere Bücher, die hier reingehören würden, aber fünfzehn reichen erstmal, finde ich! Des Weiteren gibt es einige wichtige kürzere Artikel der rezenten Yogaforschung, aber dazu mehr in einem anderen Blogpost.
Ich möchte außerdem noch vorwegnehmen, dass ich natürlich nicht hinter jedem Inhalt der Empfehlungen stehe, sondern hier und da auch Kritik oder abweichende Meinungen habe. Allerdings bin ich von der grundlegenden Qualität der im Folgenden aufgelisteten Veröffentlichungen überzeugt.
Los geht's!
1. Mallinson, James & Singleton, Mark (2017). Roots of Yoga. London: Penguin. (Englisch)
2017 erschien endlich ein absolutes Überblickswert von James Mallinson und Mark Singleton, zwei der führenden Forscher des Haṭhayoga Projects, im Zuge dessen von 2015-2020 ein Haufen bisher unbekannter Haṭhayoga-Texte übersetzt wurde, die bald erscheinen sollten. Dementsprechend ist Roots of Yoga KEIN Buch über die Wurzeln des Yogas per se sondern der Haṭhayoga-Tradition. Natürlich gehen die Autoren dabei auch auf Tantra, Pātañjala Yoga etc. ein. Es ist ein dicker, aber erschwinglicher Schinken, den man nicht von vorne bis hinten lesen muss, es ist möglich, einfach einzelne Kapitel zu lesen, die einen besonders reizen, wie etwa "Posture", "The Yogic Body" oder "Liberation". Oder man stöbert im ausführlichen Glossar nach Texten oder Stichworten und sucht zum Beispiel "locks (bandhas)". Dann kann an den angegebenen Stellen nachlesen, in welchen Texten und in welchen Zusammenhängen bandhas im Laufe der Zeit vorgekommen sind.
2. De Michelis, Elizabeth (2004). A History of Modern Yoga: Patañjali and Western Esotericism. London: Continuum. (Englisch)
Elizabeth De Michelis' Buch von 2004 kann als Startschuss der heutigen Yogaforschung gesehen werden. Die Autorin geht pointiert dem Kulturaustausch nach, der zwischen dem kolonialisierten Indien des späten 19. Jhs. (mit Fokus auf den einflussreichen Brahmanen Swāmi Vivekānanda) und dem euroamerikanischen Kulturraum stattgefunden hat. Sie argumentiert überzeugend, dass modernes körperorientiertes Yoga, oder "Modern Postural Yoga", wie sie es prominent bezeichnet, auf diesen Austauschprozessen beruht und ohne sie nicht zu verstehen ist, also heutiges, körperorientiertes Yoga nicht unidirektional aus Indien stammt. Im zweiten Teil ihres Buches analysiert sie verschiedene Einflüsse auf B.K.S. Iyengars Lehre und zeigt, wie sehr die Weltsicht und die Lehre des großen Gurus einerseits von Neo-Vedānta und New Age geprägt war und wie sie sich andererseits im Laufe seiner großen Buchveröffentlichungen veränderte, auch da Iyengar sie mehr und mehr an sein primär westliches Publikum anpasste.
3. Singleton, Mark (2010). Yoga Body. New York: Oxford University Press. (Englisch)
Ein zweiter absoluter Meilenstein, der nicht nur ein neues Jahrzehnt, sondern wenn man so will eine Art neue Ära in der Yogaforschung einleitete, ist Mark Singletons erschwingliches Buch Yoga Body von 2010. Noch 10 Jahre später reagieren viele, die davon noch nie gehört haben, beinahe ungläubig auf seine These: Seiner historischen und empirischen Forschung nach hatte die Körperkulturbewegung, die im frühen 20. Jahrhundert in Amerika und Europa (und übrigens von dort aus auch in Indien) extrem erfolgreich war, großen Einfluss auf die Genese modernen Yogas. Der Autor hat viele Beispiele und Bilder im Gepäck, die das Buch anschaulich und überzeugend gestalten, auch wenn die indologisch-historische Forschung einige der Thesen von Yoga Body mittlerweile weitergedacht hat (darunter Singleton selbst, s. Buchtipp Nr. 1 in dieser Liste). Sehr überzeugt hat mich seine These, dass die Körperkulturbewegung eine Art weltanschauliches Nährbecken war für das, was in den 1920er/1930er Jahren langsam unter dem Namen "Yoga" in den euroamerikanischen Kulturraum einreiste. Wer vorher bereits seit vielen Jahren in den Gruppenstunden der Körperkulturisten (rhythmisch) getanzt, geturnt und den Körper bewusst wahrgenommen hatte, wer tief und lebendig geatmet und sich gedehnt hatte, und all diese Praktiken häufig mit einer spirituellen Komponente versehen hatte, ordnete das neu eintreffende āsana-basierte "Yoga" automatisch in diese bereits bestehenden Raster und Interpretationsmuster ein. Dadurch verwandelte Yoga, das bereits von indischen Reformern an die Moderne angepasst worden war, von Anfang an seine Gestalt, zum Beispiel veränderte sich die dahinterstehende Motivation. Lest das Buch am Besten selbst, um euch ein eigenes Bild von Singletons Argumenten zu machen oder zum Einstieg seinen kurzen englischen Artikel im Yoga Journal, oder hört euch die brandneue Podcastfolge mit Singleton von Yogic Studies an. Die Auseinandersetzung mit Yoga Body lohnt sich noch immer und weitet den Horizont.
4. Fuchs, Christian (1990). Yoga in Deutschland: Rezeption, Organisation, Typologie. Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer.(Deutsch)
Okay, das ist nun ein ganz schöner Oldie, but Goodie. Christian Fuchs, der durch seine Arbeit beim BDY großen Einfluss auf die Organisation von Yoga in Deutschland ab den 1990er Jahren nahm, brachte mit seiner 1990 veröffentlichten Doktorarbeit das erste Mal Licht in die vielfältige Rezeption von Yoga in Deutschland, von den Anfängen der (vorerst rein philosophischen und psychologischen) Rezeption im frühen 20. Jh. bis in die späten 1980er Jahre. Wer sich dafür interessiert, wie die Deutschen ihren Blick auf Yoga im Laufe der Zeit veränderten und wer Interesse an deutscher Geschichte hat, sollte sich das Buch besorgen. Nur weiß ich leider nicht, wo man es noch herbekommt - bibliothekarisch oder antiquarisch?
5. Baier, Karl (1998). Yoga auf dem Weg nach Westen. Würzburg: Königshausen & Neumann. (Deutsch)
Karl Baiers Buch von 1998 hingegen war lange vergriffen, wurde nun aber neu aufgelegt und ist wieder für aktuell knappe 30 € auf dem Markt. Das historisch ausgerichtete Buch des Wiener Professors war für mich zu Anfang meiner Studien der Rezeption des Yogas in Deutschland ein Gamechanger. Yoga wurde im frühen 20. Jh. einige Jahrzehnte lang nicht mal mit einer Körperpraxis assoziiert? C.G. Jung war fasziniert von Kuṇḍalinī Yoga (was damals etwas anderes war, als es heute ist)? Die Nazis bereicherten sich an der Bhagavad Gītā und rechtfertigten ihre mörderischen Taten unter anderem mit dem Prinzip der Indifferenz dem eigenen Handeln gegenüber? Baier spannt einen weiten Bogen, vom Mittelalter über die Tiefenpsychologie zu den sehr einflussreichen Yoga-Autoren J.W. Hauer und Mircea Eliade der 1930er Jahre. Ich denke, einige der Tendenzen, die sich auch heute noch im Yoga in Deutschland finden, lassen sich ohne diesen historischen Hintergrund nicht verstehen und so bildet man möglicherweise blinde Flecken aus, die Weitergehen und Innovationen verhindern.
6. Swāmi Hariharānanda Āraṇya (1983 [1963]). Yoga Philosophy of Patañjali. Albany: State University of New York Press. (Englisch)
Die nächsten vier Bücher befassen sich mit Patañjalis Yogasūtra, ein altes Werk, das von Anfang an eine große Faszination auf die moderne Yogabewegung ausgeübt hat. Gleich die erste Yogasūtra-Empfehlung geht in die inhaltliche Tiefe: Das umfangreiche (und schwere!) Buch von Swāmi Hariharānanda umfasst sowohl eine englische Übersetzung des Sūtra-Teiles, als dessen Autor bekanntlich Patañjali gilt sowie des Yogabhāṣyas – der älteste Kommentar zum Yogasūtra –der traditionell einem Autor namens Vyāsa zugeschrieben wird. Dieser autoritative Kommentar ist bisher viel zu selten aus dem Sanskrit übersetzt worden und Hariharānandas Übertragung ist wohl die zugänglichste, auch wenn das Englische hier und da etwas holprig klingt. Sowieso hat der Swāmi, den man durchaus als praktizierenden Yogin bezeichnen kann, die englische Übersetzung nicht selbst zu verbuchen. Er fertigte sein Werk zuerst auf Bengalisch an, bis es ein Herr Mukerji ins Englische übertrug. Hariharānanda war ein Anhänger der Sāṃkhya-Philosophie, auf der die Weltsicht und die Praktiken des Yogasūtras grundlegend aufbauen und er war der Leiter des Kāpila-Klosters in Kurseong, Westbengalen. Viele Jahre seines Lebens verbrachte er laut Vorwort des Buches meditierend in indischen Höhlen und sein Wissen über Yoga scheint er nicht zuletzt dem Yogabhāṣya zu verdanken gehabt zu haben, das Werk, das er in Yoga Philosophy of Patañjali nicht nur übersetzt, sondern auch selbst kommentiert. Mittlerweile ist es eine weit verbreitete Lehrmeinung, dass dieser älteste Kommentar zum Yogasūtra eigentlich ein Autokommentar desselben ist. Das hieße es gäbe keinen Patañjali und keinen Vyāsa, sondern nur einen wie auch immer genannten Autor, der das gesamte Werk verfasst hat – was keine Seltenheit wäre. Zieht man also den Kommentar hinzu, gewinnt das aphoristische Sūtra bedeutend an Aussagekraft. Zum Beispiel liest man im Bhāṣya über das zweite der fünf niyamas, satya, „die Wahrheit (sprechen)“, dass dies die Übereinstimmung von Sprache und Geist mit Fakten sei, also zu sagen und zu denken, was man gesehen, gehört oder geschlussfolgert hat (vgl. Hariharānanda, S. 208). Wenn Du als Yogalehrerin das Yogasūtra sogar weitergibst und lehrst, ist es eine Überlegung wert, das Bhāṣya zu Rate zu ziehen, um nicht nur eigene Assoziationen zum Text, sondern auch traditionelle Interpretationen zu kennen.
7. Palm, Reinhardt (2010). Der Yogaleitfaden des Patañjali. Stuttgart: Reclam (Deutsch)
Wenn ich gefragt werde, ob es eine gute, akademische deutsche Übersetzung des Yogasūtras gibt, dann empfehle ich Reinhard Palms Yogaleitfaden des Patañjali. Zwar liegt schon seit 1976 mit Bettina Bäumers Veröffentlichung eine deutsche Übersetzung einer Indologin vor, kommentiert von P.Y. Deshpande, jedoch ist diese (wenngleich gute) Übersetzung oftmals nicht so nah am Text, wie die von Palm und der Kommentar von Deshpande führt sehr in die Weite. Da ist Palms knappes Büchlein, der zwar Indologie studiert hat, jedoch als Dr. phil. anderweitig akademisch tätig war, meiner Ansicht nach oft klarer. Selten geht seine Besprechung eines Sūtras länger als eine Seite, trotzdem gewährt er vielfältige Einblicke in die traditionelle Kommentarliteratur des Yogasūtras sowie in andere yogische Traditionen wie den Haṭhayoga. Ich finde, ein Buch, das deutschsprachige Yogasūtra-Interessierte auf jeden Fall zu Rate ziehen sollten, wenn sie ein Sūtra nachschlagen möchten und verschiedene Perspektiven willkommen sind.
8. Bryant, E. F. (2009). The Yoga Sutras of Patañjali. A new Edition, Translation and Commentary. New York: North Point Press. (Englisch)
Eine weitere Empfehlung ist die Yogasūtra-Ausgabe des Indologen Edwin Bryant. Ich habe das dicke Taschenbuch schon mal in einem Flughafenbuchladen entdeckt und auch der Preis ist dementsprechend angenehm, doch lässt das keineswegs auf die inhaltliche Qualität des Buches schließen. Hervorzuheben ist die umfangreiche Einleitung: Auf fast 60 Seiten geht Bryant die Geschichte des Yogas und des Yogasūtras nach. Zwar kann zum Beispiel die Frühgeschichte des Yogas betreffend über seinen Standpunkt gestritten werden (Stichwort Industalkultur), jedoch gibt der Autor einen guten Überblick über das Thema und geht auch auf verschiedene Standpunkte ein. Bryant beschäftigt sich oft ausführlicher mit dem Verständnis der Sätze seitens der großen Kommentatoren als Palm und greift häufig auf sein breites Wissen über die indische Kultur- und Geistesgeschichte zurück. Trotzdem lässt schon der Tatbestand, dass das Vorwort von B.K.S Iyengar verfasst wurde, darauf schließen, dass sich Bryant bewusst über sein maßgebliches Publikum ist: Yogainteressierte und Yogalehrende, für die er übrigens auch regelmäßig Workshops anbietet. Ebenfalls bewusst sollte dem/der LeserIn sein, dass Bryant eine theistische Lesart des Textes verfolgt, die durchaus legitim ist, jedoch bei Weitem nicht die einzige mögliche Sicht auf den Text darstellt.
9. White, David Gordon (2014). The Yoga Sutra of Patanjali. Princeton: Princeton UP. (Englisch)
White geht in seinem rezeptionsgeschichtlichen Buch über das Yogasūtra auf ähnliche Rezeptionsgruppen ein wie Baier (die Theosophen, die frühen Indologen, Hegel und die deutsche Romantik, die ersten indischen Wissenschaftler, Swāmi Vivekānanda), liefert jedoch weitere interessante Details über den indischen Kulturraum. Dazu gehören z. B. seine Ausführungen über das ‚Yogasūtra‑Revival‘ in Südindien im 16.-18. Jh., oder seine Analyse von Krishnamacharyas ominösem Umgang mit dem Text. Damit bricht das Buch dann leider auch ab und berücksichtigt die so wichtigen Entwicklungen in der Folge von Krishnamacharya hin zum heutigen Status Quo nicht mehr. White schildert eindrücklich, wann das Yogasūtra von welchen Gruppierungen wie verstanden wurde, aber auch auf welche Weise es instrumentalisiert wurde, und zeigt, dass eine "originale" Lesart des Textes – falls es diese jemals gab – keinesfalls die Rezeptionsgeschichte bestimmte. Übrigens sicherlich ein Grund dafür, dass Vyāsas Kommentar bisher so vernachlässigt wurde.
10. Foxen, Anya P. (2020). Inhaling Spirit. Harmonialism, Orientalism, and the Western Roots of Modern Yoga. New York: Oxford University Press. (Englisch)
Anya Foxens erst 2020 erschienenes Buch schließt grob an Singletons Forschung an, geht jedoch in einigen Punkten deutlich in die Tiefe. Wer sich für Vorläufer einiger Aspekte heutiger Yogapraxis in der euroamerikanischen Geschichte interessiert, wird das Buch zu schätzen wissen. Es gäbe hier sehr viel zu sagen, doch um mich kurz zu fassen, lasse ich Foxen zur Einführung selber sprechen: "Examining this history can help us understand a number of crucial features found in today’s Western, specifically American, yoga communities, such as their emphasis on asana almost to the exclusion of everything else, their nonsystematic engagement with breath, and their attention to aesthetic form even in the face of an emphasis on natural and intuitive movement. Music in yoga classes does not make a whole lot of sense if one tries to find precedent for it in Patanjali’s Yoga Sutras or medieval hatha yoga traditions. It does make sense if one considers it in light of the long-standing Western notion that music is the closest thing to spirit, which is all over European Renaissance sources and can from thence be traced back all the way to Platonism and Pythagoreanism." (S. 42) Spannend, oder?
11. Bronkhorst, Johannes (2011). Karma. Honolulu: University of Hawai’i Press. (Englisch)
Tatsächlich ging meine schriftliche Magisterprüfung in der Indologie über Karma. Ich habe 13 Seiten geschrieben (per Hand!) und war sehr fasziniert von dem Thema. Als Vorbereitung dafür habe ich zwei Bücher gelesen: Neben Wilhelm Halbfass' Karma und Wiedergeburt im indischen Denken, das man sich schnell schnappen sollte, da es nicht mehr aufgelegt zu werden scheint, wühlte ich mich durch Johannes Bronkhorsts Karma. Letzteres ist ein überschaubares Büchlein von ca. 120 Seiten und es deckt die wichtigsten Strömungen der indischen Kulturgeschichte und ihre Vision von Karma ab, vor allem geht der Autor auf den Brahmanismus (Hinduismus), den Buddhismus und den Jainismus ein. Besonders erstaunlich fand ich die Erkenntnis, dass die Vorstellung von Karma, die untrennbar mit der des Kreislaufs der Wiedergeburten zusammenhängt, im frühen vedischen, also im brahmanischen Kanon noch nicht vorkommt. Hingegen sind Karma und Wiedergeburt grundlegende Säulen von Buddhas und Jinas Weltbild, die Gründergestalten jener zwei Randbewegungen, die als Buddhismus und Jainismus bekannt werden sollten. Bronkhorst argumentiert demnach, dass sich im 1. Jahrtausend vor Christus Weltsicht und Lehre der Brahmanen veränderten. Neben solchen spannenden historischen Überlegungen stellt man sich bei der Lektüre Fragen, die unser heutiges Nachdenken über Karma meist außen vor lässt: Wo genau im menschlichen Gebilde wird Karma eigentlich gespeichert? Ist es als eine Art materielle Substanz zu verstehen? Wie geht Karma, wenn der materielle Körper vergeht, von einer Wiedergeburt in die nächste über und wie wird es wirksam? Äußert es sich vor allem körperlich, emotional oder mental? Wer oder was hat alles Karma? Wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben alle Traditionen unterschiedliche Antworten auf diese tiefgehenden philosophischen Fragen...
12. Simpson, Daniel (2021). The Truth of Yoga. New York: North Point Press. (Englisch)
Daniel Simpsons Überblicksbuch über die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte Yogaforschung ist noch nicht erschienen, es kommt im Januar 2021 in die virtuellen Läden. Mir liegt es bereits zur Review vor, und auch wenn ich noch nicht durch bin, ist es eindeutig eine gute Anschaffung für Yogaübende und -lehrende, da das Buch zum einen auch für diese Zielgruppe verfasst wurde und zum anderen in knappen Worten so einiges verständlich zusammenfasst, was die zuvor aufgezählten Bücher herausgearbeitet haben. Durchaus praktisch!
13. Remski, Matthew (2019). Practice and all is Coming. Abuse, Cult Dynamics, and Healing in Yoga and Beyond.Rangoria: Embodied Wisdom Publishing. (Englisch)
Da es nicht recht zum kultur- und geistesgeschichtlichen Fokus dieser Liste passt, war ich unsicher, an welche Stelle mit diesem wichtigen Buch. Also einfach mitten rein. Mit Fokus auf Pattabhi Jois' Ashtanga Yoga diskutiert Matthew Remskis Veröffentlichung eindrücklich die erschütternden Enthüllungen, die im Zuge der #MeToo-Bewegung im Yogaumfeld ans Licht kamen. Die Lektüre von Remskis Buch, in dem der Autor eine Vielzahl ausgesprochen mutiger und lange Zeit unterdrückter Stimmen betroffener Schülerinnen von Jois zusammenträgt, ist wirklich fordernd. Allerdings ist sie meiner Ansicht nach unumgänglich, wenn man ein Teil jener Yogabewegung sein möchte, der an vorderster Front weiterdenkt, was Yoga heute sein kann und der sich klar darüber ist, was die Yogabewegung dringend hinter sich lassen muss. Einen kürzeren Einblick in das Thema Yoga und sexueller Missbrauch bietet Remskis Artikel im Magazin TheWalrus.
14. Baier, Karl / Maas, Philipp A. / Preisendanz, Karin (Hg.) (2018). Yoga in Transformation. Historical and Contemporary Perspectives. Göttingen: V&R unipress (Englisch)
Abschließend gibt's noch zwei Tipps für Sammelbände, die Artikel verschiedener AutorInnen beinhalten. Der von Baier, Maas und Preisendanz herausgegebene, 631 Seiten starke Band ist in zwei große Themekomplexe unterteilt: "Yoga in South Asia and Tibet" und "Globalized Yoga". Damit deckt er sowohl Beiträge der indologischen und tibetologischen, sprich der philologisch-historischen Forschung ab, als auch die religionswissenschaftliche, soziologische und ethnographische Perspektive auf das Phänomen modernes, transkulturelles Yoga. Somit sind zum einen wichtige indologische Arbeiten vertreten, wie der empfehlenswerte Artikel von Philipp Maas, "'Sthirasukham Āsanam': Posture and Performance in Classical Yoga and Beyond" sowie von Jason Birch "The Proliferation of Āsana-s in Late-Medieval Yoga Texts". Zum anderen finden sich auch soziologisch-religionswissenschaftliche Artikel wie der meiner Professorin Anne Koch, "Living4giving: Politics of Affect and Emotional Regimes in Global Yoga" oder der Bremer Professorin Beatrix Hauser: "Following the Transcultural Circulation of Bodily Practices: Modern Yoga and the Corporeality of Mantras". Hausers Artikel hatte mein Interesse besonders geweckt, da sie die heute gängige Praxis des Mantrasingens nicht nur im indischen Kulturraum verortet, sondern auch mit der euroamerikanischen Kulturgeschichte in Verbindung bringt. Sie argumentiert, dass eine ähnliche Praxis schon bei unseren Urgroßeltern en vogue war und resümiert: "This nexus of voice training, mantra chanting and yoga continues to the present with only varied terminology." (S. 522)
15. Newcombe, Suzanne / O'Brien-Kop, Karen (Hg.) (2020). Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies. London, New York: Routledge. (Englisch)
Okay, zu diesem druckfrischen Buch kann ich eigentlich noch nichts sagen! Außer, dass es auf jeden Fall gut, lesenswert, mind blowing sein wird, das steht wohl außer Frage, nur ist es bisher leider noch etwas teuer. Besonders gespannt bin ich auf die Artikel "Decolonizing Yoga" von Shameem Black, "The scholar-practitioner of yoga in the western academy" von Mark Singleton und Borayin Larios, "Yoga and meditation in modern esoteric traditions" von Julian Strube, "Observing yoga: the use of ethnography to develop yoga studies" von Daniela Bevilacqua, "The psychophysiology of yoga: characteristics of the main components and review of research studies" von Laura Schmalzl, Pamela Jeter und Sat Bir Singh Khalsa sowie auf Matylda Ciołkosz' Ausführungen zu "Yoga: between meditation and movement". Wer also auf der aktuellsten Wissenswelle der rezenten Yoga- und Meditationsforschung surfen möchte, der liest sich hier besser flott ein. Ich bin dran... Wer ist dabei? 🤓
Ich freue mich über Fragen, Anmerkungen oder Erfahrungsberichte mit den 15 Büchern! Und wenn Du Dir eins besorgst und auf Instagram teilst, freue ich mich, wenn Du mich taggst: Auf @yoganerds_de schreibe ich wöchentlich über spannende Themen aus der Yogageschichte. Stay tuned and nerdy!